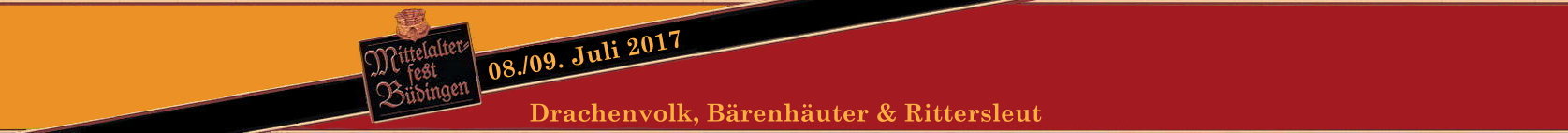Hexenwahn & Teufelsglaube
Sonderausstellung im Büdinger Heuson-Museum
24. Juni – 19. November 2017
Büdingen war zwischen 1530 und 1700 ein Zentrum der Hexenverfolgung. Die neue Ausstellung zeigt auf 24 großformatigen und reich bebilderten Informationstafeln die Ursachen, Motive und Hintergründe des gnadenlosen Vorgehens gegen so genannte Hexen in der gesamten Grafschaft Ysenburg. Dargestellt werden im einführenden Teil die Rechtsgrundlagen, auf denen die Anklage der Hexerei beruhte. Im zweiten Teil wird auf die Ursachen eingegangen, die schließlich in eine Massenpsychose gegenseitiger Anklagen und Denunziationen mündeten. Dabei steht die Rolle der Kirchen, der Obrigkeit und der Bevölkerung im Mittelpunkt. Die Gegner der Hexenverfolgung kommen ebenfalls zu Wort. Eine Liste aller Opfer ruft die damals unschuldig Verfolgten in unser Bewusstsein.
Bei den rechtlichen Grundlagen ist die „Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V.“ als erstes allgemeines deutsches Strafgesetzbuch zu nennen. Dort wurden die Regeln für die Prozesse festgelegt. In dieser Infogruppe wird auch eine Auswahl der Folterwerkzeuge, die eingesetzt wurden um die gewünschten Aussagen zu erpressen, gezeigt. Nicht fehlen darf eine Auflistung der Zeichen, an denen „Hexen“ erkannt werden.
Bei den Ursachen für den Hexenwahn wird auf die oft katastrophale Ernährungssituation, auf Glaube und Aberglaube, die Rolle der Kirchen und deren Hauptvertreter, auf die Haltung der Bevölkerung und der Obrigkeit eingegangen. Eine weitere Tafel ist dem „Hexenhammer“ gewidmet, der zur Legitimation der Hexenverfolgung diente.
Systematische Verfolgung funktionierte nur bei großer Übereinstimmung zwischen Obrigkeit, Kirchenvertretern und Volk. Die Verfahren wurden hauptsächlich von weltlichen Institutionen angestrengt und vor staatlichen Gerichten verhandelt. Die weltliche Herrschaft musste dazu bereit sein, Hexenprozesse zu fördern / zu tolerieren. Sie stellte ihren Verwaltungs- und Justizapparat hierfür zur Verfügung.
Der Glaube an Hexen, Zauberer und den Teufel als Person entstand aus einer Vermischung von heidnischen und christlichen Glaubensvorstellungen. Angestachelt wurde die allgegenwärtige Angst von den Predigten der Pfarrer und den Nachrichten über immer neue Prozesse und Hinrichtungen.
Denunziationen erfolgten auch aufgrund von Neid, Eifersucht, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder einem Streit ums Erbe. Mancher Ehemann versuchte auf diese Weise, sein „böses Weib“ loszuwerden. Heiler und Heilerinnen wurden von Ärzten der Hexerei beschuldigt, um unliebsame Konkurrenz auszuschalten.
Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung sind die Gegner der Hexenverfolgung wie Anton Praetorius, Friedrich Spee & Johann Matthäus Meyfart. Anton Praetorius war ein reformierter Theologe. Er wurde 1596 von Graf Wolfgang Ernst von Büdingen und Birstein zum fürstlichen Hofprediger nach Ysenburg-Birstein berufen. Da er sich für der Hexerei angeklagte Frauen einsetzte, behielt er seinen Job nicht lange.
Bei der Darstellung der Hexenverfolgung in der Grafschaft Ysenburg wird auch auf die Haltung und Verhaltensweisen der in der Zeit der Verfolgung amtierenden Grafen eingegangen. Da die Hexenprozesse von weltlichen Gerichten durchgeführt wurden, hätten die Grafen die Möglichkeit gehabt, die Verfolgung zu stoppen oder zumindest einzudämmen. Die Büdinger Grafen schritten jedoch weder gegen die Verleumdungen der von den Pfarrern aufgestachelten Bevölkerung noch gegen ihre Amtmänner ein. Der Büdinger Oberamtmann Johann Joachim Hartlieb war der schlimmste „Schreibtischtäter“ der Büdinger Hexenprozesse. Hartlieb war fest überzeugt, dass der Teufel leibhaftig auf Erden umherstreife und suche, wen er verschlingen könne. Die „schwachen“ Frauen verfielen ihm nur zu schnell, und um den Glauben und die Kinder nicht zu gefährden, müssten diese ohne jedes Mitleid in Gottes Namen vernichtet werden. Ein wesentliches Werkzeug in Hartliebs und der Pfarrer Hand war die Kirchenordnung von 1628, welche von den Grafen Wolfgang Heinrich und Philipp Ernst z. Y. u. B. erlassen worden war.
Auf fünf Tafeln sind die Opfer der Anklagen und Prozesse der Grafschaft Ysenburg aufgeführt. Jeder Name ist wichtig, denn die Erinnerung an diese Opfer zu erhalten ist das Einzige, was bleiben wird.
Die Ausstellung ist vom 24. Juni bis zum 19. November 2017 zu sehen. Die Anschaulichkeit der Bilder und die vielseitigen Textauszüge eignen sich hervorragend für Schüler ab der Jahrgangsstufe acht, um Quellenarbeit im Museum zu betreiben. Zur Eröffnung der Ausstellung am 24. Juni um 14.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen.